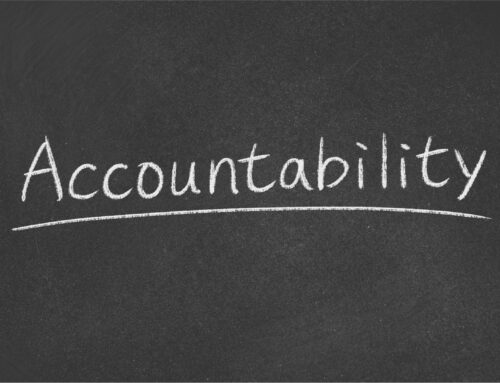Executive Summary

Konflikte gehören zum Geschäftsalltag – doch ungelöst oder schlecht moderiert werden sie zum teuren, kulturzerstörenden Risiko. Viele Führungskräfte und sogar Geschäftsführer sind in Konfliktmoderation weder geschult noch geübt. Das zeigt Wirkung: Betriebsklima leidet, Produktivität sinkt, Kosten steigen – bis hin zu Fluktuation und krankheitsbedingten Ausfällen.
Dieser Beitrag fasst – basierend auf der Podcast-Episode – zusammen, warum Konflikte so belastend sind, woran Sie Eskalation frühzeitig erkennen, wie Sie im Sinne von Daniel Dana (Conflict Resolution) wirksam moderieren und ab wann die Eskalationsstufen nach Glasl externe Hilfe nahelegen. Sie erhalten einen praxisnahen Leitfaden für die Moderation (von Auftragsklärung über Gesprächsstruktur bis Follow-up) sowie zwei reale Einblicke aus der Beratungspraxis: einmal mit positivem Ausgang, einmal mit der klaren Konsequenz, dass ohne Bereitschaft keine Moderation trägt. Ziel ist ein sicheres, alltagstaugliches Vorgehen, mit dem Sie Konflikte früher klären, Vertrauen wiederherstellen und Leistungsfähigkeit stabilisieren.
Einleitung
„Teurer Streit“ ist kein Schlagwort – er ist Alltag. In vielen Unternehmen fällt auf, dass selbst gestandene Führungskräfte beim Thema Konfliktmoderation unsicher sind. Nicht, weil der Wille fehlt, sondern weil Routine und Training fehlen. Die Folgen zeigen sich leise und stetig:
- Die Stimmung kippt, Misstrauen wächst.
- Zeit und Energie wandern aus der Wertschöpfung in Reibung.
- Konflikte verbreitern sich seitlich – Kolleginnen und Kollegen werden in Koalitionen
- Am Ende stehen Kosten: verlorene Arbeitszeit, Fluktuation, Krankentage.
Zur Brisanz genügen wenige Kennzahlen aus dem Skript: In einer US-Studie verbringen Mitarbeitende durchschnittlich 2,8 Stunden pro Woche mit Konflikten – auf den Monat gerechnet 11,2 Stunden pro Kopf. In Großbritannien wurden die Kosten von Arbeitsplatzkonflikten auf rund £1.000 pro Mitarbeiter:in und Jahr beziffert. Für Deutschland lässt sich sagen: Konflikte tragen spürbar zur Stressbelastung bei – psychische Erkrankungen verursachen mehrere zig Milliarden Euro Wertschöpfungsausfälle.
Mit anderen Worten: Konflikte sind ein Management-Thema – kein „weiches“ Nebenfeld. Die gute Nachricht: Mit klarem Handwerkszeug und rechtzeitigem Eingreifen lassen sich viele Konflikte schnell und respektvoll klären. Dieser Beitrag zeigt, wie.
1. Warum Konflikte so teuer sind – und was das für Ihren Führungsalltag bedeutet
Konflikte sind nicht automatisch schlecht. Sie zeigen oft unverträgliche Erwartungen, unklare Rollen oder widersprüchliche Prioritäten. Problematisch wird es, wenn sie eskalieren oder liegen bleiben. Dann passieren drei Dinge gleichzeitig:
- Produktivitätsverlust
Zeit wandert in Diskussionen, Rechtfertigungen und „Nebenkriegsschauplätze“. Rechnen Sie nur die 11,2 Stunden pro Monat (2,8 h/Woche) pro Mitarbeitenden auf ein Team hoch – das summiert sich zu vollen Arbeitstagen, in denen keine Wertschöpfung - Klima-Erosion
Sichtbare und unsichtbare Lager bilden sich. Menschen umgehen einander, Informationen fließen schlechter, Verlässlichkeit Das lähmt Zusammenarbeit – lange bevor jemand kündigt. - Kostenlawine
Das Spektrum reicht von Fehlzeiten über Leistungseinbußen bis Fluktuation. Allein der britische Richtwert von £1.000 pro Kopf/Jahr verdeutlicht die Größenordnung. In den Studien scheinbar nich nicht berücksichtigt kommt der Beitrag konfliktgetriebener Stressbelastung hinzu, die insgesamt zu Wertschöpfungsausfällen im mehrstelligen Milliardenbereich führt.
Fazit: Es geht nicht um „nett miteinander sein“, sondern darum Wertschöpfung zu sichern! Und genau hier setzt ein strukturiertes Konfliktvorgehen an.
2. Frühwarnsignale: Woran Sie erkennen, dass jetzt moderiert werden muss?
Konflikte starten selten laut. Bevor sie sichtbar eskalieren, gibt es Mikro-Signale:
- Wiederkehrende Missverständnisse („Das hatte ich anders verstanden…“)
- Zunehmend schärferer Ton in Mails oder Meetings
- Umgehungsstrategien (man spricht übereinander statt miteinander)
- Zeitliche Verzögerungen ohne klare Gründe
- Koalitionen („Man ist sich einig, dass …“ – aber niemand sagt es der anderen Seite)
Spätestens wenn Koalitionsbildung beginnt und Image-Sorge ins Spiel kommt (Stufe 4 nach Glasl), ist der Punkt erreicht, an dem Führung aktiv moderieren sollte. Nur durch die beteiligten Parteien und ohne klares Format wird die Klärung immer unwahrscheinlicher.
3. Orientierung mit Glasl: Von „selbst klären“ bis „ohne Dritte geht es nicht“
Die Eskalationsstufen nach Glasl beschreiben sehr präzise, wie Konflikte kippen. Wichtig ist die handlungsleitende Logik:
- Stufen 1–3 (Win-Win): Verhärtung → Debatte/Polemisierung → Taten statt Worte.
In dieser Zone können die Parteien häufig selbst klären – vorausgesetzt, sie bekommen Struktur und Raum. - Stufen 4–6 (Lose-Win): Sorge um Image & Koalitionen → Drohstrategien → Gesichtsverlust.
Ab hier sollte moderiert werden – durch Führung oder interne Fachstellen – weil die Parteien allein oft nicht mehr allein aus dem Konflikt he - Stufen 7–9 (Lose-Lose): “Begrnzte Vernichtungsschläge” → Zersplitterung des Gegenübers → Gemeinsam in den Abgrund.
Jetzt ist die Moderation meist überfordert. Es braucht professionelle Mediation, formale Verfahren – oder klare Trennungsentscheidungen.
Kernbotschaft: Früh handeln. Je höher die Stufe, desto enger der Handlungskorridor und desto teurer die Konsequenzen.
4. Konfliktmoderation nach Daniel Dana: Konflikt-Moderation für Führungskräfte
Der Ansatz von Daniel Dana (Conflict Resolution) ist für den Unternehmensalltag gemacht. Er ist strukturiert, lösungsorientiert und arbeitsbezogen – und stärkt die Alltagskompetenz von Führungskräften. Die Leitgedanken:
- Allparteilichkeit im Prozess, Parteilichkeit fürs Unternehmen
Sie stehen nicht „gegen“ eine Person, sondern für tragfähige Zusammenarbeit. - Interessen statt Positionen
Hinter „Positionen“ („Ich will X“) liegen Bedürfnisse (Sicherheit, Fairness, Klarheit). Die werden verhandelt. - Konkrete Vereinbarungen
Am Ende stehen sichtbare, überprüfbare Verabredungen – nicht Appelle.
Warum das passt: Führungskräfte brauchen kein Mediationszertifikat, um wirksam zu moderieren. Sie brauchen Rahmen, Sprache, Haltung – genau das liefert DANA in handhabbarer Form.
5. Der Moderations-Leitfaden: Schritt für Schritt sicher durch die Klärung
5.1 Vorbereitung: Auftrag, Setting, Bereitschaft
- Auftrag klären: Worum geht’s konkret – und was soll nach dem Gespräch besser laufen?
- Bereitschaft einholen: Ohne Ja beider Seiten keine Sonst eskaliert das Gespräch selbst.
- Zeit & Raum planen: 2–3 Stunden, ungestört, Luft nach hinten – keine „30-Minuten-Schnellkur“.
- Rolle klären: Ich moderiere den Prozess, nicht den Inhalt. Ich bin für das Unternehmen parteiisch – nicht für eine Person.
5.2 Start: Regeln, Zielbild, Sicherheit
- Regeln vereinbaren: Ausreden lassen, keine Schuldzuweisungen, Ich-Botschaften, respektvoller Ton.
- Zielbild definieren: Woran merken wir am Ende, dass es besser ist?
Sicherheitsnetz: Bei starken Emotionen Prozess-Unterbrechung erlauben (kurze Pause, neu fokussieren).
5.3 Exploration: Aktiv zuhören & spiegeln
- Einzelne sprechen lassen, die andere Seite hört aktiv
- Danach: Paraphrase („Bitte wiederholen Sie kurz, was Sie gehört haben.“).
- Moderator: Hervorheben, was wichtig war („Habe ich richtig verstanden, dass …?“).
- Emotionen zulassen – nicht bagatellisieren. Erst wenn das verstanden ist, entsteht die Basis für Lösungsideen.
5.4 Optionen & Kriterien: Gemeinsam in den Lösungsmodus
- Ideen sammeln, ohne sofort zu bewerten.
- Kriterien vereinbaren (z. B. Fairness, Umsetzbarkeit, Termintreue).
- Lösung(en) gegen Kriterien prüfen – nicht gegeneinander.
5.5 Vereinbarungen & Follow-up
- Konkrete Vereinbarung schriftlich festhalten: Wer macht was bis wann?
- Unterschrift beider Seiten kann sinnvoll sein – erhöht Verbindlichkeit.
- Follow-up festlegen: 2–4 Wochen später kurzer Review (gern 2–3 Termine).
- Wenn die Umsetzung stockt oder Rückfälle auftreten: nächste Stufe (interne Fachstelle, externer Coach/Mediator).
6. Praxis: Was funktioniert – und wo die Grenze liegt
6.1 Positives Beispiel: Vertrauen wiederherstellen
In einer Teamcoaching-Sitzung trat ein Konflikt zwischen einem geschäftsführenden Gesellschafter und einer Führungskraft offen zutage. Beide erklärten ihre Bereitschaft zur Konflikt-Moderation. Mit den o. g. Schritten (Zielklarheit, Regeln, Interessen, Vereinbarungen) entstand wieder Vertrauen.
Wirkung: Vertrauensgewinn auf beiden Seiten, spürbar besseres Abteilungsklima, weniger Seitendynamiken, mehr Fokus auf Arbeit – ein gewinnbringender Reset.
6.2 Grenzfall: Wenn Bereitschaft fehlt
In einem anderen Fall (zwei Geschäftsführer-Brüder) gab es zunächst Kooperation zur Konflikt-Moderation, später keine Bereitschaft mehr – weder für interne Moderation noch für externe Mediation. Konsequenz: Die Lage verschärfte sich zum Nachteils des Unternehmens.
Lehre: Ohne tragfähige Verabredung, sich auf den Prozess einzulassen, ist Moderation nicht möglich. Dann braucht es formale Schritte – bis hin zur Trennung von Beteiligten.
7. Klare Grenzen ziehen: Wenn Trennung Kultur schützt
Auf hohen Eskalationsstufen (7–9) stößt Moderation an Grenzen. In großen Unternehmen lassen sich Personen ggf. so versetzen, dass sie nicht mehr zusammenarbeiten. In kleineren Organisationen – etwa in Autohäusern, wo die Prozesse eng verzahnt sind – ist das oft unmöglich. Dann bleibt manchmal nur die Trennung von einer (oder sogar beiden) Seiten.
So hart es klingt – im Sinne von Betriebsklima und Kultur kann genau das das deutlichste Signal sein: Diese Form der Eskalation wird nicht toleriert. Gerade in Zeiten von Fachkräftemangel ist das eine unbequeme, aber konsequente Entscheidung im Sinne der Leistungsfähigkeit.
8. Ihr Werkzeugkasten für den Alltag: Früh eingreifen – professionell vorgehen
Wenn Sie merken „es eskaliert“ (spätestens bei Koalitionen/Image-Sorge):
- Gesprächsbereitschaft beider Seiten aktiv einholen.
- Zeit/Ort festsetzen (2–3 Stunden, ungestört).
- Rolle & Regeln klar kommunizieren: Ich moderiere den Prozess.
- Exploration: Sprechen – Zuhören – Paraphrasieren – Emotionen anerkennen.
- Optionen/Kriterien → Vereinbarung
- Follow-up in 2–4 Wochen (ggf. mehrfach).
- Scheitert die Umsetzung: nächste Eskalationsstufe (intern/extern).
Do’s & Don’ts
- ✅ Ich-Botschaften, aktives Zuhören, Fairness
- ✅ Allparteilichkeit im Prozess, klare Parteilichkeit für das Unternehmen
- ✅ Konkrete Vereinbarungen statt Appelle; Nachverfolgung statt Mikromanagement
- ❌ Kurzformate unter Zeitdruck („machen wir eben schnell“)
- ❌ Schulddebatten statt Lösungsfokus
- ❌ Wegschauen, obwohl Koalitionen offen sind
9. Der Business Case: Zahlen, die wachrütteln
- 2,8 Stunden pro Woche verbringen Mitarbeitende im Durchschnitt mit Konflikten → 11,2 Stunden pro Monat.
- £1.000 pro Person/Jahr als Richtwert für Konfliktkosten (UK).
- Konfliktgetriebene und damit unnötige Stressbelastung trägt zu Wertschöpfungsausfällen im mehrstelligen Milliardenbereich
Übertragen auf Ihr Unternehmen: Multiplizieren Sie 11,2 Stunden mit Ihrer Belegschaft und Ihrem Stundensatz – die Größenordnung wird schnell deutlich. Und das sind nur die direkten Zeitverluste. Indirekte Effekte (Kundenfokus, Innovationskraft, Geschwindigkeit) sind mindestens ebenso relevant.
10. Vom Einzelfall zur Routine: Wie Sie nachhaltige Kompetenz aufbauen
Ein Training allein reicht nicht. Führungskräfte brauchen Gelegenheit und Ermutigung, das Gelernte anzuwenden. Empfehlenswert sind:
- Regelmäßige Kurz-Reflexionen: „Welche Spannungen gab es? Haben wir sie geklärt?“
- Peer-Austausch: Führungskräfte sprechen nach Moderationen kurz über Vorgehen & Lerneffekte.
- Leitfäden & Templates: Ein Ablauf, eine Vereinbarungsvorlage, ein Follow-up-Sheet.
- Kulturelle Klarheit: Wir klären Spannungen früh – respektvoll, strukturiert, verbindlich.
So entsteht Sicherheit im Vorgehen – und Konfliktklärung wird Teil der Arbeitskultur.
Fazit
Konflikte verschwinden nicht, wenn man sie ignoriert – sie kosten. Zeit, Energie, Geld und Vertrauen. Die gute Nachricht: Mit frühzeitiger, strukturierter Moderation und klaren Eskalationskriterien lassen sich viele Konflikte schnell und respektvoll klären. Daniel Danas Conflict-Resolution-Ansatz liefert dafür alltagstaugliche Werkzeuge, die Glasl-Stufen geben eine klare Orientierung, ab wann interne Moderation reicht und ab wann externe Hilfe sinnvoll ist. Entscheidend sind Bereitschaft, Struktur und Nachverfolgung – dann wird aus „teurem Streit“ geklärte Zusammenarbeit.
Beste Grüße
Björn Johannsmeier
PS: Sie möchten Ihre Führungskräfte für Konfliktmoderation stärken – praxisnah, respektvoll, wirksam? Dann begleite ich Sie gern: von der Kompakt-Schulung bis zur Fallmoderation und Routinen-Einführung. Vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch – und bringen Sie Konflikte auf Klärungskurs. Wenn Sie mehr zum Thema Unternehmenskulturgestaltung erfahren möchten, clicken Sie bitte hier.