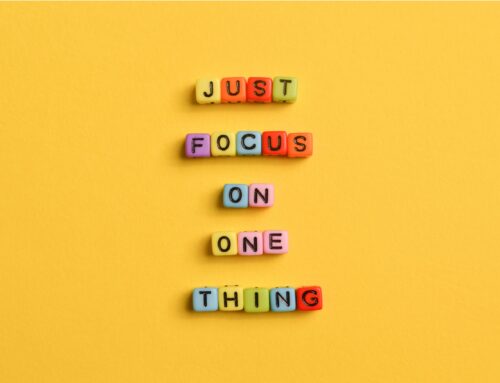Executive Summary
 Viele Führungstrainings überfrachten junge Führungskräfte mit Theorie – aber im Alltag braucht es vor allem Klarheit und Verlässlichkeit. In dieser Episode fokussiere ich auf das Einmaleins wirksamer Führung nach Fredmund Malik: Resultatorientierung, Beitrag zum Ganzen, Konzentration auf Weniges, Stärken nutzen, Vertrauen sowie positiv-konstruktives Handeln. Ich zeige, warum diese sechs Grundsätze heute wichtiger sind denn je, wie Sie sie in Ihrem Unternehmen pragmatisch verankern und welche typischen Stolpersteine Sie vermeiden. Ergänzend erhalten Sie konkrete Hinweise aus der Praxis – von Fokusfenstern ohne Ablenkung über den Umgang mit Zielkonflikten bis zu einer verlässlichen Meetingkultur. Am Ende finden Sie zwei Leseempfehlungen, die das Fundament sinnvoll erweitern. Mein Ziel: Ihnen als Unternehmer oder Geschäftsführerin ein robustes, sofort nutzbares Führungs-Framework an die Hand zu geben, das ohne Moden auskommt – und Wirkung zeigt.
Viele Führungstrainings überfrachten junge Führungskräfte mit Theorie – aber im Alltag braucht es vor allem Klarheit und Verlässlichkeit. In dieser Episode fokussiere ich auf das Einmaleins wirksamer Führung nach Fredmund Malik: Resultatorientierung, Beitrag zum Ganzen, Konzentration auf Weniges, Stärken nutzen, Vertrauen sowie positiv-konstruktives Handeln. Ich zeige, warum diese sechs Grundsätze heute wichtiger sind denn je, wie Sie sie in Ihrem Unternehmen pragmatisch verankern und welche typischen Stolpersteine Sie vermeiden. Ergänzend erhalten Sie konkrete Hinweise aus der Praxis – von Fokusfenstern ohne Ablenkung über den Umgang mit Zielkonflikten bis zu einer verlässlichen Meetingkultur. Am Ende finden Sie zwei Leseempfehlungen, die das Fundament sinnvoll erweitern. Mein Ziel: Ihnen als Unternehmer oder Geschäftsführerin ein robustes, sofort nutzbares Führungs-Framework an die Hand zu geben, das ohne Moden auskommt – und Wirkung zeigt.
Einleitung
Junge Führungskräfte starten heute häufig mit einer „Hochdruckbetankung“ aus Modellen und Ansätzen. Das fühlt sich zunächst nach Fortschritt an – bis die erste volle Woche im Job kommt: Gespräche mit Mitarbeitenden, Kundentermine, Entscheidungen unter Zeitdruck, Zielkonflikte zwischen Bereichen. Genau dann entscheidet sich, ob Training Handwerk vermittelt hat – oder nur Begriffe.
In meinen Trainings und Gesprächen mit Unternehmern erlebe ich immer wieder: Die Basics fehlen. Nicht, weil Menschen nicht motiviert wären. Sondern weil das, was wirklich trägt, in der Theorieflut untergeht. Hier lohnt ein Blick auf das, was Fredmund Malik klar und systematisch herausarbeitet. Er unterscheidet zwischen Grundsätzen (wie geführt wird), Aufgaben (was Führung sicherstellt) und Werkzeugen (womit geführt wird). In diesem Beitrag konzentriere ich mich bewusst auf die Grundsätze – also auf den Rahmen, der Entscheidungen und Verhalten im Alltag leitet.
Warum das so wichtig ist? Weil Grundsätze Orientierung geben, wenn es unübersichtlich wird. Sie helfen, Prioritäten zu setzen, Konflikte zu klären und Verlässlichkeit aufzubauen – ohne jedes Mal nach einem neuen Modell suchen zu müssen. Wer die Grundsätze versteht, teilt und konsequent anwendet, wird schnell wirksam. Das gilt besonders für Menschen, die neu in einer Führungsrolle sind – aber ebenso für erfahrene Leitungsteams, die ihre Zusammenarbeit stabilisieren wollen.
Im Folgenden führe ich Sie Schritt für Schritt durch die sechs Grundsätze wirksamer Führung, übersetze sie in konkrete Handgriffe und zeige, woran ich in der Praxis erkenne, ob eine Führungskraft auf dem richtigen Weg ist.
Wirksam führen – worauf es wirklich ankommt
Wirksamkeit heißt, die richtigen Dinge richtig zu tun. Es geht nicht darum, etwas „schön“ zu formulieren, sondern darum, Entscheidungs- und Umsetzungsfähigkeit zu erhöhen. In unsicheren oder komplexen Situationen hilft kein Methodenfeuerwerk, sondern ein klarer Kompass. Maliks Grundsätze liefern genau das. Sie sind einfach, aber nicht simpel: Jeder Grundsatz verlangt bewusste Entscheidungen, klare Kommunikation und konsequentes Nachhalten.
Wenn ich mit jungen Führungskräften arbeite, ist der rote Faden stets derselbe: Erwartungen klären, Prioritäten setzen, Stärken nutzen, Vertrauen schaffen – und konstruktiv bleiben, auch wenn es hart wird. Genau so entsteht ein Umfeld, in dem Leistung möglich ist und Verantwortung gerne übernommen wird.
Die folgenden Kapitel übersetzen diese Idee in sechs greifbare Prinzipien.
Grundsatz #1: Resultatorientierung – „Woran erkennen wir Erfolg?“
Resultatorientierung bedeutet: Nicht Beschäftigung, sondern Ergebnisse zählen. Gerade am Anfang einer Führungsrolle ist das ein mächtiger Hebel. Wer schon zu Beginn transparent macht, welches Ergebnis erwartet wird – in Qualität, Zeit und Verantwortung –, reduziert Missverständnisse und hilft dem Team, sich zu organisieren.
Woran es in der Praxis hängt:
- Erwartungen werden zu allgemein formuliert („Bitte kümmern“ statt „Bis Freitag 12 Uhr, Qualitätsstandard X“).
- Es wird viel über Fleiß gesprochen, aber wenig über Wirkung.
- Deadlines gelten „so ungefähr“ – das schwächt Verlässlichkeit und damit Ihren Ruf als Führungskraft.
Was sofort hilft:
- Ergebnisbilder sprechen: „Am Ende dieser Woche liegt eine getestete Lösung vor, die X erfüllt.“
- Qualität + Zeit klären: „Gilt nur, wenn Qualität X erreicht ist.“
- Transparenz schaffen: Ergebnisse sichtbar machen (z. B. Board oder kurzer Status im Teamtermin).
- Konsequent nachhalten: Wer Zusagen ernst nimmt, fördert Lernkurven – und ermöglicht, sich gezielt zu entwickeln.
Resultatorientierung schafft Klarheit. Sie nimmt den Druck, überall zugleich exzellent sein zu wollen, und lenkt Energie dorthin, wo sie zählt.
Grundsatz #2: Beitrag zum Ganzen – weg von Bereichslogik, hin zum Gesamtnutzen
Viele Zielkonflikte entstehen, weil Bereichsziele und Gesamtziele nicht gut aufeinander abgestimmt sind. Ich erlebe das häufig in der Diskussion um variable Vergütung: Wenn einzelne Abteilungen ausschließlich an ihren Kennzahlen gemessen werden, überrascht es nicht, dass Silos entstehen. Die Folge: Reibung, Verzögerungen, teure Fehlanreize.
Woran Sie das erkennen:
- Führungskräfte sagen: „Ich bin der Einzige, der ans Ganze denkt.“
- Bereiche optimieren auf ihren Ausschnitt – auch wenn das dem Unternehmen schadet.
- Entscheidungen werden „verhandelt“, statt am besten Beitrag fürs Ganze ausgerichtet.
Was in der Praxis wirkt:
- Gemeinsame Ziele ergänzen: Neben individuellen Zielen mindestens eine Gesamtunternehmens-Kennzahl verankern.
- Entscheidungsfrage etablieren: „Welche Option erhöht den Gesamtnutzen?“ – und das kurz begründen.
- Zielkonflikte früh moderieren: Wenn „Lager“ entstehen, klären Sie die gemeinsame Wirkung – und legen Sie Spielregeln fest.
- Anreize überprüfen: Variablen so gestalten, dass Zusammenarbeit belohnt wird – nicht Abgrenzung.
„Beitrag zum Ganzen“ ist ein Haltungsanker. Wer sichtbar pro Unternehmen entscheidet und das begründet, baut Vertrauen auf – über Bereichsgrenzen hinweg.
Grundsatz #3: Konzentration auf Weniges – Fokus gewinnt
Zwischen E-Mails, Chats und Ad-hoc-Themen verschwimmt schnell, was jetzt wichtig ist. „Konzentration auf Weniges“ heißt: bewusst abwählen, Stopps aussprechen und Fokuszeiten schützen.
Typische Irrtümer:
- „Multitasking“ sei machbar. – Nein: Wir können umschalten, aber nicht gleichzeitig volle Aufmerksamkeit auf zwei anspruchsvolle Aufgaben richten. Das geht auf Kosten der Qualität.
- „Alles ist wichtig.“ – Wenn alles Priorität hat, hat nichts Priorität.
So setzen Sie Fokus praktisch um:
- Priorität ist singular (ein Thema vornehmen!): Für Team und Führungskraft – was bewegt diese Woche/den heutigen Tag, die nächste Stunde wirklich den Zeiger?
- Fokusfenster einführen: Zeitblöcke ohne Störungen; Benachrichtigungen aus, Tür zu, Notfälle klar definiert.
- Parkplatz nutzen: Neues kommt zunächst auf eine Liste. Nur wenn ein Thema eine Top-Priorität verdrängt, darf es rein.
- Altlasten prüfen: Routinen, Berichte, Meetings – was einmal sinnvoll war, ist es nicht automatisch heute noch. Dafür hilft eine “not any more to do” Liste!
Fokus ist keine Starrheit, sondern Disziplin. Sie schafft Arbeitsruhe – und damit Qualität.
Grundsatz #4: Stärken nutzen – Aufgaben so zuschneiden, dass Menschen glänzen
Perfekte Mitarbeitende gibt es nicht. Aber es gibt sehr wohl Teams, in denen Menschen wirksam sind – weil Aufgaben so zugeschnitten werden, dass Stärken zum Tragen kommen und Defizite abgesichert sind.
Was das praktisch heißt:
- Stärken sichtbar machen: Was kann jede Person besonders gut? Worin hat sie Energie?
- Rollen danach gestalten: Aufgaben und Projekte so zuweisen, dass Signatur-Stärken wirken – statt sie im Defizit-Pingpong zu verlieren.
- Entwicklung planen: Stärken fördern heißt nicht, Schwächen ganz zu ignorieren. Es heißt, gezielt zu entwickeln – dort, wo es für die Rolle zählt – und nicht nur bei den Schwächen sondern vor allem in den Stärken.
So entsteht ein Umfeld, in dem Menschen gerne Verantwortung übernehmen – weil sie spüren, dass sie wirksam sein können.
Grundsatz #5: Vertrauen – Verlässlichkeit statt Angstkultur
Wer Vertrauen will, muss Verlässlichkeit bauen. Das beginnt bei klaren Erwartungen und sichtbaren Zusagen – und setzt sich fort in einem Umgang, der Angst abbaut statt aufbaut. Ich denke dabei an die Grundidee, Furcht aus Organisationen zu nehmen – nicht, um Probleme zu beschönigen, sondern um Lernen und Verbesserung zu ermöglichen.
Verlässlichkeit stärken – drei Punkte:
- Erwartungen klar vereinbaren: Was genau wird bis wann geliefert – und in welcher Qualität?
- Zusagekultur leben: Zusagen gelten. Und wenn sie nicht zu halten sind, wird früh neu verabredet – proaktiv.
- Rituale nutzen: Regelmäßige kurze Abstimmungen, in denen Fortschritte, Hindernisse und nächste Schritte transparent werden.
Vertrauen ist kein „weiches“ Thema. Es ist ein Produktivitätsfaktor. Wo Menschen ohne Gesichtsverlust Fragen stellen und Risiken ansprechen können, wird schneller gelernt – und besser geliefert.
Grundsatz #6: Positiv & konstruktiv – Probleme ernst nehmen, Lösungen zuerst
Schwächen zu erkennen, ist leicht. Konstruktiv zu bleiben, ist Arbeit. Es geht nicht um rosa-rote Brillen. Im Gegenteil: „Bad news first“ – aber mit Lösungssuche. Ein Grundoptimismus ist hier kein Schönreden, sondern die Haltung, dass sich Dinge verbessern lassen.
So sieht das im Alltag aus:
- Reihenfolge bewusst setzen: Erst Chancen und Lösungsansätze, dann Risiken.
- Kritik koppeln: Jede Kritik enthält einen Verbesserungsvorschlag.
- Sprache prüfen: Weg von „die da oben“/„die da drüben“, hin zu „wir“ und „das Ganze“.
Konstruktivität zieht Kreise: Sie reduziert Eskalation, beschleunigt Entscheidungen und macht Zusammenarbeit leichter.
Vorbildwirkung: Verhalten prägt Kultur
Führung wirkt nicht zuerst durch Worte, sondern durch Beispiel. Wenn Sie verlässlich sind, werden es andere. Wenn Sie sichtbar fürs Ganze entscheiden, verringern sich Silos. Wenn Sie fokussiert arbeiten, wird der Umgang mit Zeit respektvoller. Diese Vorbildwirkung ist ein starker Hebel – und oft unterschätzt.
Sie müssen dafür nicht „Schauspieler“ sein. Es reicht, wenn Haltung und Handlung zusammenpassen. Kleine, konsequente Gesten (pünktlich starten, Entscheidungen begründen, Lerneffekte benennen) formen mehr Kultur, als zehn Folien es je könnten.
So verankern Sie die sechs Grundsätze im Führungsteam – ein praxistauglicher Fahrplan
Die sechs Grundsätze entfalten ihre Wirkung, wenn sie sichtbar werden – für Sie, Ihr Führungsteam und Ihre Mitarbeitenden. Ein kompakter Start kann so aussehen:
- Kick-off im Führungskreis (60–90 Min.)
- Gemeinsames Verständnis der sechs Grundsätze klären.
- Je Grundsatz eine konkrete Verhaltensweise festlegen, die Sie ab sofort leben (z. B. Fokusfenster, Zusagekultur).
- Resultate sichtbar machen
- Was sind die wichtigsten Ergebnisse der nächsten zwei bis vier Wochen?
- Welche zwei bis drei Entscheidungen würden mit klarem Ergebnisbild schneller laufen?
- Gesamtnutzen prüfen
- Wo schlagen die Bereichsziele das Gesamtziel?
- Welche gemeinsamen Kennzahlen brauchen wir (ergänzend zu individuellen)?
- Fokus etablieren
- DAS Top Thema bzw. die Priorität fürs Team benennen; alles andere auf den Parkplatz.
- Fokusfenster definieren; Benachrichtigungen aus, Notfälle klären.
- Stärken kartieren
- Was kann jede Person besonders gut?
- Welche Aufgabe lässt sich so zuschneiden, dass die Stärke sofort wirkt?
- Verlässlichkeit sichern
- Am Ende jedes Termins: Was ist bis wann, durch wen, in welcher Qualität zu liefern?
- Frühzeitig neu verabreden, wenn Hindernisse auftreten.
- Konstruktivität kultivieren
- In Teamrunden erst Lösungen, dann Risiken.
- Jede Kritik mit Verbesserungsvorschlag.
Dieser Fahrplan ist bewusst leichtgewichtig. Er verzichtet auf zusätzliche Bürokratie und schafft stattdessen Arbeitsruhe, Tempo und Orientierung.
Ergänzende Lektüre – sinnvoll aufbauen, nicht überladen
Wenn Sie das Fundament vertiefen möchten, empfehle ich zwei Bücher, die zum hier beschriebenen Ansatz passen – nicht, um noch mehr Theorie hinzuzufügen, sondern um das Praktische zu stärken:
- Fredmund Malik: „Führen, Leisten, Leben“ – die Grundordnung wirksamer Führung, klar strukturiert und gut auf den Alltag übertragbar.
- „First, Break All the Rules“ – Forschung aus der Praxis, die zeigt, was gute Führungskräfte tatsächlich tun (u. a. Stärkenorientierung, sinnvolle Fragen an Teams).
Ergänzend: „Now, Discover Your Strengths“ – für den Einstieg in Stärkenarbeit mit Teams.
Diese Lektüre verbindet sich mit den sechs Grundsätzen zu einem robusten System: kein Modenkarussell, sondern ein bewährter Rahmen, der Entscheidungen und Handeln erleichtert.
Fazit
Gute Führung ist kein Geheimnis – aber sie ist entscheidungsstark, diszipliniert und menschlich. Maliks sechs Grundsätze liefern dafür ein solides Fundament: Resultatorientierung schafft Klarheit, Beitrag zum Ganzen löst Silos auf, Konzentration auf Weniges erzeugt Arbeitsruhe, Stärken nutzen erhöht Wirksamkeit, Vertrauen beschleunigt Lernen und konstruktives Handeln hält Teams lösungsfähig – gerade dann, wenn es schwierig wird.
Wenn Sie diese Prinzipien klar benennen, sichtbar leben und in wenigen, guten Routinen verankern, entsteht eine Führungskultur, die Leistung ermöglicht und Menschen mitnimmt. Das ist kein großer Apparat. Es ist konsequentes Handwerk – Tag für Tag.
Herzliche Grüße
Björn Johannsmeier – Ihr Corporate Culture Consultant, Stressmanagement-Trainer & Executive Coach
PS: Sie möchten die Führungs-Basics in Ihrem Unternehmen stärken – ohne Theorie-Overload, dafür mit sichtbarer Wirkung? Gern begleite ich Sie: kompakte Workshops für junge Führungskräfte, klare Routinen für Führungsteams, praxistaugliche Umsetzung im Alltag. Klicken Sie hier für ein unverbindliches Erstgespräch – wir klären, was für Sie am meisten bewirkt. Mehr Informationen zum Executive Coaching finden Sie hier.